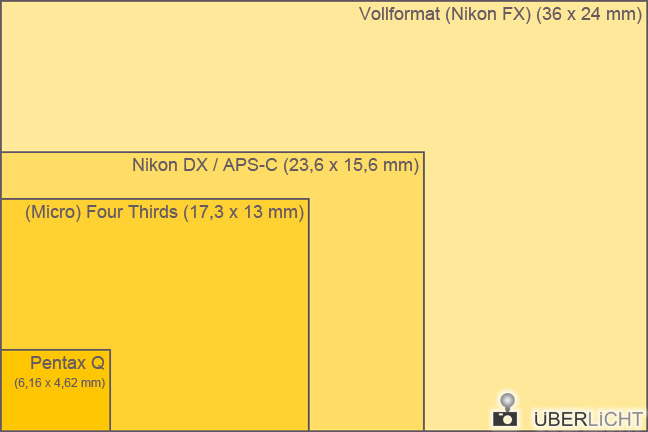Licht, das durch ein kleines Loch in einen dunklen Raum fällt, projiziert auf die gegenüberliegende Wand ein kopfstehendes, spiegelverkehrtes Bild der Außenwelt. Das Prinzip der Camera Obscura ist spätestens seit Aristoteles bekannt, Leonardo da Vinci machte es praktisch anwendbar und ab dem 17. Jahrhundert wurde die Camera Obscura (teilweise mit Linsen bestückt) von Malern genutzt, die ihr Motiv über einen Spiegel auf eine Mattscheibe umlenkten, um es dort direkt abzeichnen zu können. Als Joseph Nicéphore Niépce um 1826 die erste Fotografie anfertigte, verwendete er schon eine fachmännische Camera Obscura mit Linse.

Isar, München (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick
Lochkamera
Gleichwohl ist es auch möglich, vollkommen ohne Linse zu fotografieren mit der einfachsten Art der Camera Obscura: einer Lochkamera. Die gleichmäßige Unschärfe (und zugleich große Tiefenschäfe) von Lochkamera-Fotografien begeisterte schon die Menschen des ausklingenden 19. Jahrhunderts. Und selbst wenn ein in schwarzen Karton oder Alufolie gestochenes Loch genügt, um ein erkennbares Bild zu erzeugen, sucht man in der Praxis häufig auch bei der Lochblende die bestmögliche Schärfe und Präzision.

Picknick an der Isar, München (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick
Lochblende
Im Allgemeinen bekannt ist: Je kleiner die Blende, desto schärfer die Abbildung. Jedoch hat diese Annahme leider ihre physikalischen Grenzen: Einerseits tritt bei sehr kleinen Blenden Unschärfe durch die Beugung des Lichts an Kanten (der Lochblende) auf, was wiederum den Lichtwellen zuzuschreiben ist. Zudem verlängert sich mit kleinerer Blendenöffnung die Belichtungszeit, was angesichts des Schwarzschildeffekts (bei Filmmaterial) oder erhöhtem Rauschverhalten (bei digitalen Sensoren) wenig förderlich ist.
Formeln
Den Kompromiss zur besten Schärfe hat bereits 1891 Lord Rayleigh in einer einfachen Formel zusammengefasst:
D = 1,9 × (f × l)0,5
(D: Durchmesser der Lochblende in mm; f: Auszug bzw. Abstand Lochblende-Filmebene in mm; l: Wellenlänge des Lichts ca. 0,00055 mm für Grün-Gelb – das für Menschen sichtbare Lichtsprektrum reicht ca. von 400 nm bis 750 nm).
Will man aus dem Lochdurchmesser die Blendenzahl (k) errechnen, hilft folgende Formel:
k = f ÷ D

Boote am Strand, Rügen (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick

Steine in der Brandung, Rügen (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick

Seebrücke in Binz, Rügen (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick
Meine Ausrüstung
Soviel zur Theorie, ich habe es mir leicht gemacht und fürs Erste eine fertig umgebaute Agfa Clack bei eBay gekauft. Die ist zuverlässig und leicht zu bedienen. Ins Gepäck kommen neben Kamera, Belichtungsmesser, Drahtauslöser und einem kompakten, leichten Stativ (z. B. Slik Sprint Mini) auch einige Rollfilme und eine kleine Sammlung von Schwarzschildtabellen.
gekauft. Die ist zuverlässig und leicht zu bedienen. Ins Gepäck kommen neben Kamera, Belichtungsmesser, Drahtauslöser und einem kompakten, leichten Stativ (z. B. Slik Sprint Mini) auch einige Rollfilme und eine kleine Sammlung von Schwarzschildtabellen.
Der Schwarzschildeffekt
1899 entdeckte der Physiker Karl Schwarzschild, dass die Empfindlichkeit der Filmemulsion bei geringen Lichtwerten abnimmt. Bildlich gesprochen reagieren die Silberhalogenide bei wenig Licht etwas träge. Um eine Unterbelichtung zu vermeiden, muss also die Belichtungszeit verlängert werden. Klingt logisch; die Folge ist jedoch, dass sich nach einer Weile in der Ausrüstungstasche viele verschiedene Schwarzschildtabellen befinden, denn jeder Film reagiert anders. Informationen dazu findet man in Datenblättern der Hersteller oder durch eigene Versuche.

Zirkus auf der Theresienwiese, München (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick
Farbverschiebungen
Bei Farbfilmen ergeben sich aus den langen Belichtungszeiten auch etwaige Farbverschiebungen, die meiner Meinung nach jedoch das Ergebnis umso interessanter machen. Immerhin verwendet man eine Lochkamera nicht, um perfekte Fotografien zu erhalten. Da bietet es sich an, auch bereits abgelaufenes Filmmaterial aus dem Schrank zu holen, mit ein bisschen Glück entpuppt sich die Farbigkeit nach der Entwicklung als besonders ungewöhnlich.

Allianz Arena, München (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick
Besonderheiten
Lochkameras sind geradezu dafür gemacht, auch Dinge zu fotografieren, die sich während der Belichtungszeit verändern, seien es Fahnen oder Baumkronen im Wind, ein Fluss, das Meer, Fußgänger, fahrende Autos oder Schiffe. Womit man jedoch vorsichtig sein sollte, ist die direkte Sicht in die pralle Mittagssonne. Zwar können durch die Lichtbeugung sehr dekorative Strahlenmuster entstehen, dennoch birgt die lange Belichtungszeit auch die Gefahr, dass ein Loch in die Filmemulsion oder gar die Trägerschicht gebrannt wird. Das äußert sich im fertigen Bild zumindest in einem dunklen Fleck auf der Sonne. Des weiteren sollte man beim Fotografieren in der Abenddämmerung nicht vergessen, dass sich die Belichtungszeit durch die nachlassende Sonnenintensität stetig verlängert, was dem Fotografen zuweilen etwas Geduld abverlangen kann.

Viktualienmarkt, München (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick

Hirschgarten, München (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick
Viele Möglichkeiten
Trotz der simplen und auf das Notwendige reduzierten Konstruktion bietet die Lochkamera so einige Gestaltungsmöglichkeiten. Neben Filmmaterial lassen sich auch Fotopapiere direkt belichten. Die runde Lochblende kann je nach Belieben durch anders geformte Blendenöffnungen ersetzt werden oder auch einfach durch ein unsauber in schwarzen Karton gestochenes Loch. Als Lochkamera kann schon ein Schuhkarton fungieren. Daneben gibt es unzählige mehr oder weniger professionelle Eigenbaulösungen, die allesamt eindrucksvolle Ergebnisse liefern – man muss es nur ausprobieren.
Bildbände
Empfehlenswerte Bildbände zum Thema gibt es unter anderem von Günter Derleth („Venedig: Camera Obscura“) oder von Abelardo Morell („Camera Obscura“).

Tegernsee (2007) - Lochkamera © Marina Biederbick
Geschrieben am 22. Juni 2011 von Marina Biederbick
Kategorien: Analog, Fotografie, Kamera, Test
6 Kommentare »